VAR us d'r Kayjass: Dreimol null es null...
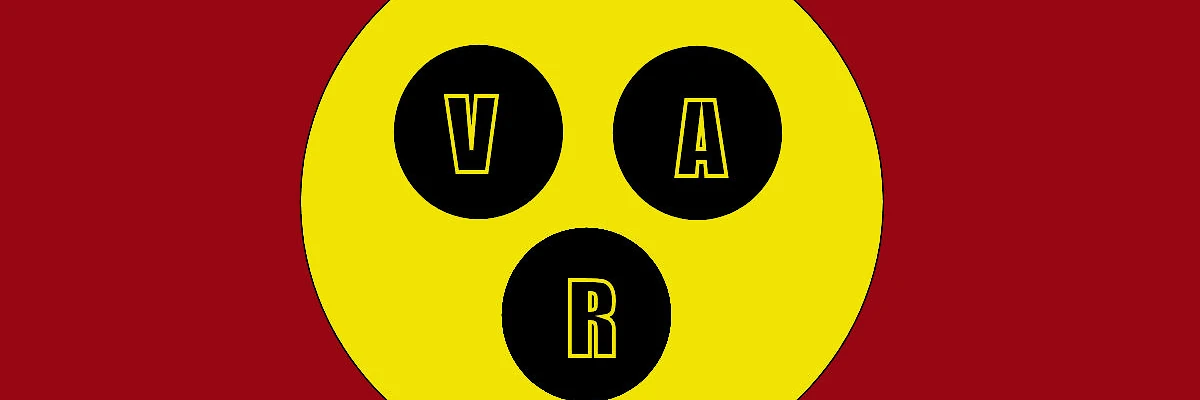
11.11.2025
Manchmal weiß man selbst nicht mehr, was sich auf dem Fußballplatz abspielt – „Nä, nä dat wesse mer nit mih, janz bestemp nit mih“, würden die Schüler der Kayjass wohl sagen. Erst zählt im Pokal gegen die Bayern ein klares Abseitstor, weil der VAR daheim geblieben ist, und kaum zwei Wochen später liegt der Videobeweis im Derby gegen Gladbach gleich dreimal daneben. Dreimol Null es Null, es Null – und genau so fühlte sich das an: drei Elfmeter, drei Fehlentscheidungen, ...okay nur zweimal Ärger, der aber keine Seite wirklich glücklich macht (außer die Anhänger der spielerisch unterlegenen Elf vom Niederrhein). Der eine ruft nach Technik, der andere nach gesundem Menschenverstand – und beide stehen am Ende mit dem gleichen Fragezeichen da. Vielleicht liegt die Wahrheit am Ende gar nicht auf dem Bildschirm, sondern da, wo sie immer lag: auf’m Platz.
Auch wenn wir alle am Pokal-Mittwoch den VAR sehnlichst vermisst haben, darf dieses isolierte Mangelempfinden nicht über die Gesamtproblematik des VAR hinwegtäuschen. Oder wenn man das wie unser Coach Kwasniok in seiner Navi-Analogie sieht, war der VAR auch für das gegebene Abseitstor ursächlich, und das obwohl kein VAR am Mittwoch in der 2.Pokalrunde teilnahm. Kwasniok verglich dasThema VAR im Fußball mit Navigationsgeräten im Straßenverkehr. Autofahrer, die sich stets auf die technische Navigationshilfe verlassen, seien ohne diese Hilfe ähnlich orientierungslos wie Schiedsrichter ohne VAR.
Der Videobeweis wurde uns einmal als das große Versprechen verkauft: mehr Gerechtigkeit, weniger Skandale, endlich Klarheit. Acht Jahre später stehen wir da wie früher, nur mit Standbild. Der VAR greift offiziell nur in vier klar umrissenen Fällen ein – Tor, Elfmeter, Rot, Verwechslung – und auch nur zur Korrektur „klarer Fehlentscheidungen“; so steht’s im Lehrbuch der DFL und klingt auf dem Papier wunderbar geordnet wie ein frisch gezogener Strafraumkreidestrich. In der Praxis entsteht daraus aber häufig ein anderer Sport: der mit der Fernbedienung in der Hand, in dem Sekundenbruchteile zerdehnt,Kontexte verdrängt und Stimmungen eingefroren werden. Das Resultat ist nicht seltener Gerechtigkeit, sondern öfter Entfremdung – und zwar messbar: Fanforscher Professor Harald Lange sagt seit Jahren, der VAR säge genau an dem Ast, auf dem der Fußball sitzt – an der Emotionalität. „Der Moment der Freude steht unter Vorbehalt“, lautet sein Befund. Wenn selbst der Torjubel im Kopf mit einem „mal abwarten“ versehen wird, kratzt das am Tafelsilber unseres Sports.
Ausgerechnet der 1.FC Köln bekam im Spiel gegen den VfB Stuttgart eine Lehrstunde, wie der Weg vomRegelwerk zur Realitätsverzerrung verläuft. Schwäbe vertändelt und setzt nach, Demirović bleibt fair auf den Beinen, weiterspielen, keiner reklamiert – und irgendwann (Minuten später) klingelt’s im Ohr: Bitte zum Monitor. Nach minutenlangem Wühlen im Pixelbeet steht ein Elfmeter, den auf dem Platz niemand gefordert hatte. Der Schiedsrichter wirkte dabei weniger wie „Herr im Haus“ sondern wie ein Untermieter in einer Wohnung, in der der Vermieter regelmäßig auf der Matte steht. Hinterher sagten die einen „der Kontakt ist ganz klar gegeben“ (mit Blick auf die Zeitlupe), die anderen „völliges Rätsel“ (mit Blick aufs Spiel). Für Kölns Bank blieb vor allem der Eindruck, der VAR suche sich die Fälle, als ginge es um True Crime statt um Fußball. Und Demirović? Der gab Schwäbe die Hand – als hätte er gerade an einerEntscheidung teilgenommen, die beide nur am Rande betraf.
Das ist der Kern des VAR-Paradoxons: Er will Fairness belohnen, bestraft aber oft Spiele, in denen Fairness gelebt wird. Empirisch betrachtet hat der Videobeweis sein großes Versprechen nie belegt. Ja, Abseitslinien kann man millimetergenau kalibrieren. Aber das Spiel ist keine Geometrieklausur. Handspielauslegungen kippen im Halbjahrestakt, Foulbewertung bleibt kontextabhängig, und selbst die heilige Objektivität der Zeitlupe isttrügerisch, weil sie Wucht und Dynamik aus Szenen saugt, bis aus Zweikampfphysik ein Tatbestandsmerkmal wird. Die DFL erklärt das System inzwischen mit Infografiken, Rollenteilungen und Prozessketten und dennoch wächst die Zahl der Momente, in denen Stadion und Sofa sich nicht abgeholt, sondern entmündigt fühlen. Mit jedem zusätzlich erklärten Detail steigt die Distanz zum eigentlich einfachen Ziel: Fußball begreifen, während er passiert. Oder wie der Kölner sagt: „Wat soll dä Kwatsch?“
Das Demirović-Dilemma zeigt exemplarisch, wie deplatziert der VAR-Eingriff in Köln war. Ein minimaler Kontakt – ja, vielleicht – aber einer, der den Spielfluss nicht im Geringsten beeinträchtigte. Schwäbe kam nicht mit offener Sohle, nicht mit gestrecktem Bein, nicht mal mit ungebremster Wucht – er wollte schlicht klären. Kein gefährliches Spiel, kein Foul im eigentlichen Sinne, eher ein typischer Zweikampf in einem Sport, der nun mal von Körperlichkeit lebt. Dass ausgerechnet solch eine Szene minutenlang unter die Lupe genommen wird, lässt Zweifel aufkommen, ob der Fußball sich noch selbst versteht. Denn wenn jeder Kontakt als Tatbestand gilt, dann bleibt vom Spiel bald nur noch das Standbild übrig. Fußball war und ist ein Kontaktsport – wer ihn steril analysiert, nimmt ihm das, was ihn ausmacht: die Dynamik, das Risiko, die Menschlichkeit. Und genau das ging in diesem Moment verloren – nicht nur für den FC, sondern für alle, die den Sport noch mit Herz statt mit Hochgeschwindigkeitskamera sehen. Was folgt daraus? Niemand verlangt Unfehlbarkeit vom Schiri. Im Gegenteil: Der Fußball hat Jahrzehnte ganz gut mit dem Prinzip gelebt, dass Fehler Teil des Spiels sind – menschlich, sichtbar, diskutierbar, ambesten am Stammtisch beim lecker Kölsch. Der VAR versprach, die größten Ausrutscher einzufangen, undöffnete die Tür für eine neue Art Unfrieden: technisch legitimiert, emotional entkernt. Wenn „Gerechtigkeit“ bedeutet, dass ein Spielgefühl in einer Zeitlupenanalyse in Dauerschleife übersetzt wird, haben wir
vielleicht das Richtige gemessen – aber das Falsche bewahrt.